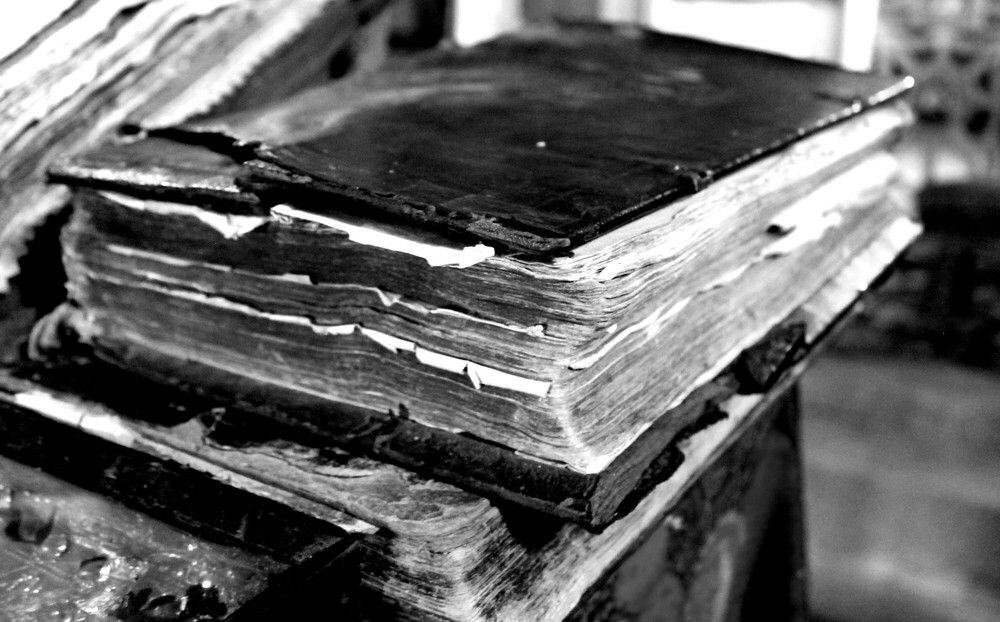Die Plansprache Esperanto, 1887 von dem polnisch-jüdischen Arzt Lazarus Ludwik Zamenhof unter dem Pseudonym „Dr. Esperanto“ (der Hoffende) veröffentlicht, sollte als neutrale internationale Verständigungssprache dienen und Brücken zwischen den Völkern bauen. Doch gerade diese friedliche Absicht machte Esperanto und seine Anhänger zu Zielen brutaler Verfolgung unter totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts.
Zamenhof wuchs in Bialystok auf, einer Stadt im damaligen russischen Reich, in der Juden, Polen, Russen, Deutsche und Weißrussen mit jeweils eigener Sprache und in gegenseitigem Misstrauen zusammenlebten. Diese Sprachenvielfalt sah er als Kern der Feindschaft zwischen den Völkern. Seine Lösung: Eine leicht erlernbare Zweitsprache für alle, die als neutrale Brücke zwischen den Nationen dienen sollte.
Esperanto zeichnet sich durch besondere Eigenschaften aus: Phonetische Schreibweise (Schrift und Aussprache sind identisch), nur 16 grammatische Grundregeln, Vokabular hauptsächlich aus romanischen Sprachen und systematischer Wortaufbau durch Präfixe und Suffixe.
Frühe Verbreitung und Spaltung der Bewegung
Die Esperanto-Bewegung breitete sich schnell in Europa aus. Der erste Esperanto-Weltkongress fand 1905 in Boulogne-sur-Mer mit etwa 700 Teilnehmern statt. 1908 gründete der Schweizer Hector Hodler den Esperanto-Weltbund (UEA), der bereits 1914 über 7000 Mitglieder zählte.
In Deutschland verlief die Entwicklung zunächst zögerlich. Trotz der Gründung der ersten Esperanto-Gruppe 1888 in Nürnberg blieb die Begeisterung anfangs verhalten. Das junge Deutsche Reich suchte nach eigenen Wurzeln und dem „Deutschtum“ – eine internationale Sprache passte nicht in dieses Konzept.
Neben der bürgerlich-neutralen Esperanto-Bewegung entstand Anfang des 20. Jahrhunderts eine Arbeiter-Esperanto-Bewegung. 1921 gründete der Franzose Eugène Adam (Pseudonym: Lanti) die SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda – Nationsloser Weltbund), eine selbständige internationale Vereinigung der Arbeiter-Esperantisten, die 1929 bereits 6500 Mitglieder zählte.
Nationalsozialistische Hetze und Ideologie
Schon vor Hitlers Machtergreifung begannen die Nationalsozialisten mit ihrer Agitation gegen Esperanto. Die Gründe waren vielfältig: Zamenhofs jüdische Herkunft wurde zum zentralen Angriffspunkt, Esperanto wurde als Bedrohung des deutschen Volkstums gesehen, und Hitler behauptete in „Mein Kampf“, Esperanto sei Teil einer jüdischen Weltverschwörung.
In „Mein Kampf“ schrieb Hitler 1925: „Solange der Jude nicht der Herr der anderen Völker geworden ist, muß er wohl oder übel deren Sprache sprechen, sobald diese jedoch seine Knechte wären, hätten sie alle eine Universalsprache (z.B. Esperanto!) zu lernen.“
Die rechtsgerichtete Presse verstärkte diese Hetze. Der „Reichswart“ schrieb 1926, Esperanto sei eine „Mißgeburt von Sprache, ohne Wurzel im Leben eines Volkes“ und diene dazu, „in den künftigen Arbeitssklaven Zions die Vaterlandsliebe ausrotten zu helfen.“ Der „Völkische Beobachter“ verhöhnte 1930 Esperanto-Anhänger, die sich „anstammeln“ würden.
Der Weg zum Verbot 1933-1936
Nach der Machtergreifung 1933 erfolgte die Verfolgung schrittweise. Im April 1933 besetzten Polizisten die Geschäftsstelle des Arbeiter-Esperanto-Bundes in Berlin und beschlagnahmten das gesamte Inventar. Der Sozialistische Esperanto-Bund löste sich am 31. März 1933 freiwillig auf. Die Esperanto-Bewegung verlor durch die Auflösung der Arbeiter-Bewegung fast drei Viertel der organisierten Esperanto-Mitglieder in Deutschland.
Der Deutsche Esperanto-Bund (DEB) versuchte verzweifelt zu überleben und beantragte im Mai 1933 die Gleichschaltung. Dieser Versuch scheiterte, doch der Bund passte sich dennoch an: Er veröffentlichte Hitler-Zitate, erklärte seine Treue zum deutschen Volkstum und führte „Richtsätze“ ein, die Mitglieder mit „staatsfeindlicher Einstellung“ ausschlossen. 1935 wurde sogar der Arierparagraph eingeführt.
Im August 1933 fand noch der 25. Esperanto-Weltkongress in Köln statt – eine taktische Entscheidung der Nationalsozialisten, um im Ausland den Anschein von Toleranz zu erwecken. Der neue Nazi-Oberbürgermeister Günter Riesen begrüßte die etwa 900 Teilnehmer im Braunhemd, ohne auch nur ein Wort über Esperanto zu verlieren.
Am 17. Mai 1935 erließ Bernhard Rust, Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung: „Die Pflege künstlich geschaffener Welthilfssprachen wie der Esperantosprache hat im nationalsozialistischen Staate keinen Raum.“ Am 20. Juni 1936 verbot Heinrich Himmler endgültig die Aktivität für den Esperanto-Weltbund und forderte alle deutschen Verbände zur Selbstauflösung auf.
Verfolgung und Widerstand
Die Verfolgung der Esperantisten unterschied sich nicht wesentlich von der anderer Minderheiten. Meist wurden die führenden Personen von der Gestapo verhaftet und in Gefängnisse oder Konzentrationslager gebracht. Hans Angermann aus Rodewisch stand zwei Jahre unter Polizeiaufsicht. Der Lehrer Schubert beging nach Folterungen im KZ Hohenstein Selbstmord. Gustav Weber wurde im KZ Gusen von einem SS-Mann erschlagen. Im KZ Dachau erteilte der Jugoslawe Jože Kozlevčar anderen Häftlingen heimlich Esperanto-Unterricht.
Die Familie Zamenhof wurde besonders hart getroffen: Adam Zamenhof (Sohn des Gründers) wurde Ende Januar 1940 erschossen. Seine Schwestern Zofia und Lidia sowie Lazarus Ludwiks Schwester Ida starben 1942 im KZ Treblinka.
Trotz der Gefahr organisierten sich viele Esperantisten im Untergrund weiter. Sie halfen politisch Verfolgten bei der Flucht ins Ausland, schmuggelten Nachrichten über die Grenze und klärten das Ausland über die wahren Zustände in Deutschland auf. Ludwig Schödl aus Berlin und Paul Göpel aus Eisenach gelang die Flucht aus Deutschland mit Hilfe von Arbeiter-Esperantisten. Eine Chemnitzer Gruppe verfasste Berichte über die Zustände in Konzentrationslagern, denen sie von den Nationalsozialisten selbst aufgenommene Bilder beifügten, die misshandelte Arbeiterfunktionäre und Juden zeigten.
Internationale Verfolgung
Die Verfolgung beschränkte sich nicht auf Deutschland. In Skandinavien und Westeuropa war die Unterdrückung vergleichsweise geringer. In Norwegen und Dänemark wurden die Esperanto-Verbände nicht verboten. Esperantisten aus Kopenhagen veröffentlichten sogar noch 1942 ein Buch, das die Einstellung der deutschen Esperantisten kritisierte. In Dänemark konnten vielen Juden durch eine geheime Telefonleitung das Leben gerettet werden.
In der Sowjetunion erlebte die Esperanto-Bewegung unter Stalin ihre schwerste Verfolgung. 1937/38 begann ohne Vorwarnung eine brutale Säuberungsaktion. Esperantisten wurden als „aktives Mitglied einer internationalen Spionageorganisation“ angeklagt und nach Sibirien deportiert. Die Überlebenschance war sehr gering, und diejenigen, die überlebten, kamen erst nach 10 bis 15 Jahren frei.
In Polen fielen nach dem Einmarsch der Deutschen besonders viele Esperantisten der Verfolgung zum Opfer. In Jugoslawien zeigte die Esperanto-Bewegung beispielhaften aktiven Widerstand. Mit dem Einmarsch deutscher Truppen in Zagreb am 10. April 1941 begann auch dort die Verfolgung. Viele Esperantisten schlossen sich den Partisanen an. Insgesamt starben 340 Esperanto-Anhänger aus Jugoslawien in Gefängnissen oder Konzentrationslagern.
In Spanien wurden Esperantisten während des Bürgerkriegs verfolgt, weil die Sprache von katalanischen Nationalisten genutzt wurde. 1937 meldete eine Radiostation in Córdoba, dass „alle Esperantisten wegen Teilnahme an antinationalen Aktivitäten ihre verdiente Strafe erhalten“ hätten. In Portugal wurden im September 1936 alle Esperanto-Gruppen aufgelöst. 1948 wurde unter der Diktatur von Salazar das Verbot sogar auf den Esperanto-Unterricht ausgeweitet. Erst 1972 wurde ein Zusammenschluss wieder erlaubt.
Politischer Wandel der Bewegung
Die neutrale Esperanto-Bewegung versuchte anfangs, sich gegen die Agitation zu wehren, indem sie ihre Neutralität betonte. Nach 1933 führte die verzweifelte Anpassungsbereitschaft zu Kritik von ausländischen Esperantisten. Als das Verbot kam, organisierten sich die meisten im Untergrund weiter.
Erst durch das Vorbild Jugoslawien entwickelte sich immer mehr ein aktiver Widerstand. Die UEA, der Esperanto-Weltbund, gab ihre „alte“ Neutralität im November 1938 auf mit folgendem Aufruf: „Gleichgültig zu bleiben, also neutral nach alter Auffassung, wäre Verrat an unseren Idealen. Esperanto steht und fällt nur mit einem Regime, das die Freiheit des einzelnen respektiert.“
1947 nahm die UEA das Prinzip der Achtung der Menschenrechte in ihre Satzung auf – ein Jahr vor der UN-Vollversammlung.
Neuanfang nach 1945
Esperanto überlebte den Faschismus. Bereits am 14. April 1946 – am 29. Todestag Zamenhofs – hissten polnische Esperantisten die grüne Esperanto-Fahne auf den Trümmern von Zamenhofs Haus in Warschau, ein starkes Symbol der Hoffnung und des Neubeginns.
In Westdeutschland war 1945 zunächst nur die Neubildung von Esperanto-Gruppen auf örtlicher Ebene erlaubt. Die Gruppen der drei Westzonen vereinigten sich im April 1947 im neu gegründeten Deutschen Esperanto-Bund (DEB). Bereits 1948 fand der Deutsche Esperanto-Kongress in München statt. 1951 wurde dort der 36. Esperanto-Weltkongress veranstaltet, bei dem der Esperanto-Platz an der Theresienwiese eingeweiht wurde.
In der sowjetischen Besatzungszone hatten sich 1945 wieder Arbeiter-Esperanto-Gruppen gebildet, die aber 1949 aufgrund einer Verordnung gegen Kunstsprachenvereinigungen aufgelöst wurden. Erst nach Stalins Tod 1953 lebte Esperanto in der Sowjetunion wieder auf. 1965 wurde Esperanto in der DDR wieder zugelassen und vom Deutschen Kulturbund gefördert. Auf dem 69. Deutschen Esperanto-Kongress 1991 in München vereinigten sich die Esperanto-Bünde aus Ost und West.
Fazit und Gegenwart
Die Geschichte der Esperanto-Verfolgung zeigt exemplarisch, wie totalitäre Regime alles bekämpfen, was Grenzen überschreitet und Menschen verbindet. Die „interna ideo“ – die innere Idee von Brüderlichkeit und Gerechtigkeit – machte Esperanto verdächtig bei allen, die auf Abgrenzung, Nationalismus und Kontrolle setzten.
Schätzungsweise ein bis drei Millionen Menschen weltweit sprechen heute Esperanto. Die Sprache wird besonders in Europa genutzt – in Frankreich, Deutschland und den osteuropäischen Staaten. Esperanto hat bewiesen: Selbst die brutalste Verfolgung konnte die Idee einer verbindenden internationalen Sprache nicht auslöschen.
Die Verfolgung der Esperantisten mahnt uns, dass Verständigung und friedlicher Austausch zwischen den Völkern immer wieder gegen nationalistische und totalitäre Bestrebungen verteidigt werden müssen. Die Esperanto-Bewegung überlebte sowohl das Nazi-Regime als auch den Stalinismus – ein Beweis für die Kraft einer Idee, die auf Hoffnung, Verständigung und Menschlichkeit basiert.
Wie Karl Breuninger treffend formulierte: „Nekredeble, Esperanto vivas!“ – „Unglaublich, Esperanto lebt!“